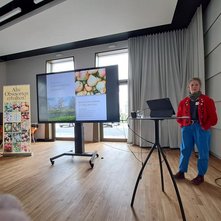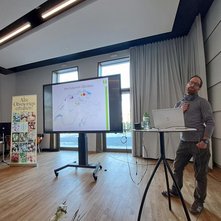Landesgruppe Baden-Württemberg
Das Geheimnis des Köhlers erkundet
Der OGV Eppingen-Rohrbach zeigt, wie aus Gartenabfällen Schwarzes Gold wird.
Die Rhein-Neckar-Zeitung (Kraichgau) vom 3. Mai 2024 hat dazu folgenden Artikel veröffentlicht:
Jahrestagung in Staufen im Breisgau
Liebe Mitglieder,
mit 56 Teilnehmern fand am 14.01.2024 die Jahrestagung in Staufen im Breisgau statt.
Am Samstag den 13.01.2024 fand nachmittags eine Wanderung durch das Obstparadies statt. Trotz der kalten Temperaturen haben 20 Personen an der Wanderung teilgenommen. Wir danken Herrn Martin Geng für die Organisation und Durchführung.
Bericht LG Baden-Württemberg Jahrestagung 2024
Obst- und Gartenbauverein Eppingen-Rohrbach
Herstellung von schwarzem Gold lockte viele Interessierte an
Schon bei der Begrüßung durch Klaus Rupp von der OGV-Vorstandschaft war eine beachtliche Gruppe von 50 Teilnehmern neben der Rohrbacher Sommerfesthalle anwesend. Die Teilnehmer waren nicht nur aus den umliegenden Ortschaften, sondern auch aus Mannheim, Brackenheim, Osterburken, Sinsheim sowie anderen Kraichgauorten angereist. Alle waren gespannt auf die Ausführungen von Siegfried Burret von der Landesgruppe Baden-Württemberg des Pomologen-Vereins. Siegfried Burret hatte seinen Kontiki-Stahlbehälter schon eine Stunde vorher mit Baumschnitt angefeuert, so dass gleich mit dem Verfahren begonnen werden konnte. Als Material hatte der OGV einen großen Traktoranhänger mit Baumschnitt bereitgestellt. Unermüdlich erklärte Burret über den ganzen Nachmittag das Verfahren und die Nutzung von Biokohle zur Herstellung von fruchtbaren Böden (Schwarzerde, Terra Preta). Kontinuierlich wurde das Schnittgut in den konischen Kontiki-Ofen eingegeben. Durch das Pyrolyse-Verfahren wird das Holz-Schnittgut bei Temperaturen zwischen 450 und 600 Grad Celsius verkohlt. Gegen 18 Uhr war das Schnittgut verbraucht und die Holzkohle wurde mit Wasser abgelöscht. Als Ergebnis blieben 90 Liter Holzkohle-Rußwasser und drei prall gefüllte Schubkarren Bio-Holzkohle übrig.
Ausgebracht auf der Baumscheibe mit Mist oder Kompost übernehmen nun die fein strukturierten Kohlepartikel die Funktion von Humus und vor allen Dingen die Wasserspeicherung. Die anwesende Karina Schwarz vom Pomologen-Landesvorstand lobte die gelungene Veranstaltung und sagte, dass die Holzkohle durch ihre poröse Struktur eine große Oberfläche besitze und insbesondere auf sandigen Böden Wasser und Nährstoffe besser gespeichert werden. Dies könne unseren Obstbäumen und Sträuchern in Zeiten der regenarmen Sommer sehr helfen.
Klaus Rupp
Jahrestagung 15.01.2023 Baden-Württemberg
Die Jahrestagung des Pomologen-Vereins, Landesgruppe Baden-Württemberg hat am 15.01.2023 in Tübingen-Bühl mit 55 Teilnehmern stattgefunden.
Vorträge:
Streuobst in Tübingen und Umgebung
Historisches zum Obstbau und zu alten Obstsorten in Tübingen. Unterscheidet sich der Zustand der Streuobstwiesen in Tübingen von dem im Rest des Landes? Gibt es Hoffnung für den Erhalt der Streuobstbestände in Tübingen?
Streuobst in Tübingen und Umgebung
Netzwerk Steuobsterlebnis Herrenberg
„Wie kann die Stadt Herrenberg Ihnen helfen?“ Der Umweltbeauftragte und das Bürgerprojekt Streuobsterlebnis stellten diese Frage Anfang 2021 an die Streuobst-Bewirtschafter:innen im Stadtgebiet. Die haben reagiert und über zweihundert ganz vielfältige Vorschläge eingereicht. Zur Umsetzung der Vorschläge gründete sich im April 2022 das „Netzwerk Streuobsterlebnis Herrenberg“. Dort sind die OGVs und andere lokale Gruppen sowie die Stadt Herrenberg selbst vertreten. Dieses lokale Netzwerk kann gezielt die ganz spezifischen Wünsche und Möglichkeiten vor Ort berücksichtigen und passende Maßnahmen aufsetzen.
Netzwerk Streuobsterelebnis Wappler
Birnbäume und ihre Früchte – sortenkundliche Betrachtung der prägendsten Birnensorten in „the land“
Birnen sind aus unserer Obstkultur nicht wegzudenken. Unsere Landesgruppe hat ihnen bereits verschiedene Aktivitäten gewidmet. Über eine Umfrage konnten wir die zehn bei unseren Mitgliedern bekanntesten Birnensorten in Baden-Württemberg ermitteln. In einem Sortenseminar im Herbst 2022 standen sie pomologisch im Blickfeld. Nun werden sie im Rahmen der Mitgliederversammlung anhand zahlreicher Bilder sortenkundlich porträtiert.
Bericht der Jahrestagung 2022 Baden-Württemberg
Die Jahrestagung des Pomologen-Vereins, Landesgruppe Baden-Württemberg hat am 25. Juni 2022 in Hohenlohe mit 33 Teilnehmern stattgefunden.
Nach der Begrüßung und einem Grußwort hat Stefan Schrempp, Sprecher unserer Landesgruppe, über das zurückliegende Jahr berichtet.
Danach hat Hannes Bürckmann in seinem Referat „Streuobstbau in Hohenlohe – wer bewahrt unser immaterielles Kulturerbe?“ die enge Beziehung zwischen dem Obstanbau in Hohenlohe und der kulturellen Bedeutung anschaulich dargestellt.
Beide Vorträge haben sich gut ergänzt und waren Grundlage für einen regen Meinungsaustausch.
Nachmittags wurden neue Produkte aus traditionellen Obstsorten in Hohenlohe vorgestellt. In kurzen Interviews konnten Manfred Böhm, Christian Haußler, Jürgen Tiefenbach und Dr. Friedrich Mertz die Hintergründe für ihre Produkte mit Leidenschaft präsentieren.
Gegen Ende der Veranstaltung hat Christoph Schulz das Problem Schwarzer Rindenbrand angesprochen und auf ein Projekt des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg hingewiesen. Hermann Schreiweis hat Hinweise zu verschiedenen Aktivitäten gegeben und Termine genannt.
Hier die wichtigsten Inhalte der Jahrestagung als PDF-Dokumente
Programm mit kurzen Anmerkungen
Vortrag „Streuobst am Wendepunkt – Neue Impulse braucht das Land!“
Vortrag „Streuobstbau in Hohenlohe – wer bewahrt unser immaterielles Kulturerbe?“
Rundschreiben der Landesgruppe Baden-Württemberg
Die Landesgruppe Baden-Württemberg informiert ihre Mitglieder mit Rundschreiben über geplante Aktionen, Exkursionen und Termine. Sie werden per Post oder E-Mail an die Mitglieder verschickt.
Hier die Rundschreiben und Berichte seit 2019 in digitaler Form:
Bericht von der Mitgliederversammlung 2021
Bericht von der Mitgliederversammlung 2020
Im Jahr 2020 haben wir unsere neue Umfrage zum Projekt gestartet:
Wir haben im Sommer 2019 in der LG eine Umfrage zur Birnenvielfalt in Baden-Württemberg gestartet, die wir an die Mitglieder versendet haben:
Baumschule Peter Schüle – Sicherung alter Steinobstsorten in Korntal
Peter Schüle war ein intelligenter, aber auch kantiger Naturbursche, der sich in seinem Leben für den Erhalt alter Obstsorten einsetzte. Sein Schwerpunkt waren Kirschsorten, Sorten, die es zum Teil nur noch in seiner kleinen Baumschule gab. Durch den plötzlichen Tod von Peter Schüle und den daraufhin folgenden Verkauf des Grundstückes schien dieser einzigartige Genpool verloren zu gehen. In den darauf folgenden Monaten begann Heiko König, ein guter Bekannter von Peter Schüle, damit, herauszufinden, was mit dem Grundstück passieren solle. Nach intensiver Recherche gelang es ihm, den neuen Eigentümer ausfindig zu machen. Es stellte sich heraus, dass der neue Eigentümer ebenfalls Schühle heißt und ebenso viel Freude an alten Obstsorten hatte. Herr Schühle bot Heiko König sofort seine Mithilfe an, um die Kirschensorten zu sichern.
Auch über den Pomologen-Verein wurde nach ehrenamtlichen Helfern gesucht. Heiko König nahm zudem Kontakt mit mehreren Erhaltungsgärten auf, um Platz für etwa 100 Bäume zu finden. Glücklicherweise sagte ihm Herr Arnold von der Stadt Esslingen zu. Er würde sich freuen, die Bäume (ca. 70 Stück) zu übernehmen. Als sich dann nach ca. 3 Wochen, 10 Freiwillige gemeldet hatten, wurde mit Herrn Schühle ein Termin vereinbart, um die Aktion durchzuführen. Es war der 22. Januar, und Petrus hatte Erbarmen mit dem Vorhaben.
Bei erträglichem, weitestgehend trockenem Wetter wurden mit Unterstützung eines Minibaggers von Galabau Schmidt aus Korntal die Bäume ausgegraben. Nach Wurzel- und Pflanzschnitt, wobei vom Schnittgut noch Edelreiser geschnitten wurden, brachte man die Bäume auf einen Anhänger. Die Edelreiser dienen der doppelten Absicherung, falls ein Baum nicht anwachsen sollte. Leider weiß niemand, welche Sorten tatsächlich vorhanden sind, es ist jedoch sicher, dass es sich um äußerst seltene Sorten handelt. Deshalb werden die Bäume in Esslingen nochmals aufgeschult, bis sie bestimmt werden können. Die restlichen kleineren Bäume wurden von Christian Wieland mitgenommen und ebenfalls bei ihm aufgeschult, sodass sie noch wachsen können. Die geschnittenen Edelreiser werden auf Unterlagen veredelt. Ein paar Kirschbäume, die wegen Ihrer Größe nicht mehr ausgegraben werden konnten, bleiben dauerhaft auf dem Grundstück stehen und dienen als Reiserquelle. Auch diese Bäume müssen noch bestimmt werden.
Alles in allem war es eine sehr angenehme Planung und Durchführung des Projekts. Bei sehr guter Verköstigung durch Renate Wieland mit Schweinebraten und anschließendem Kaffee und Kuchen ging die Arbeit leicht von der Hand. Allen Helfern hat es bei freundschaftlicher lustiger Atmosphäre sichtlich Spaß gemacht. Es war ein voller Erfolg mit einem super Team.
Sommerexkursion 2021
Am 18.07.2021 konnte die diesjährige Sommerexkursion statt finden. Wir haben uns zahlreich mit Mitgliedern und Interessierten in Tübingen getroffen. Die Vorstellung der Sortenapp durch den Kreisfachberater Herrn Thilo Tschersich sowie eine Saft- und Mostverkostung mit Herr Gerhard Helle haben den Nachmittag gestaltet.
Oeschberg-Palmer-Schnittkurs am 8. Februar 2020 in Roigheim

Zunächst trafen sich die 26 Teilnehmer zum Frühstück in einer italienischen Pizzeria in Roigheim. Nach dem ausführlichen Theorieteil ging es bei herrlichem Wetter hinaus auf ein Baumgrundstück im Gewann „Vordere Höhe“. Einleitend zeigte der Kursleiter Helmut Ritter aus Strümpfelbach an einem mitgebrachten Hochstammbaum den notwendigen Pflanzschnitt. In seiner ruhigen und sachlichen Art zeigte Helmut Ritter – unterbrochen von einer Mittagspause in der Pizzeria – bis gegen 16 Uhr an verschiedenen Bäumen den Schnitt nach der Schweizer Oeschberg-Methode. Leicht verständlich gelang es ihm, die Teilnehmer zu beeindrucken. Mit einer neuartigen Einhand-Akkumotorsäge zeigte er an einigen älteren, vergreisten Obstbäumen noch den Verjüngungsschnitt. Der Dank der begeisterten Teilnehmer galt auch dem PV-Ehrenmitglied Hermann Schreiweis, der die Veranstaltung glänzend organisierte.
Klaus Rupp
Oeschberg-Palmer-Schnittkurs in Roigheim im Januar 2019

Erfreulicherweise traf der angekündigte Eisregen nicht ein, so konnte Landessprecher Hermann Schreiweis 22 Obstbauinteressierte begrüßen. Helmut Ritter aus Strümpfelbach, ehemaliger Schüler des Obstschnitt-Experten Helmut Palmer (1930-2004) führte zunächst in der gemütlich warmen Gaststube der Pizzeria „Stern“ in Roigheim zwei Stunden in die theoretischen Grundlagen des Oeschberg-Palmer-Schnitts ein. Hierbei verteilte er auch schriftliche Schnittanweisungen und zeigte Informationstafeln.
Anschließend folgte der Praxisteil auf der Feldflur im Bereich „Vordere Höhe (Südbaum)“ an verschiedenen Obstbäumen. Mit Begeisterung waren alle Teilnehmer bis gegen 16 Uhr dabei und freuten sich auch über die Mittagspause in der wärmenden Gaststube „Stern“.
Klaus Rupp
Öschberg-Palmer-Schnittkurs in Roigheim am 17. Februar 2018

Die Bockschelle ist die Rote Dattelzwetschge
Liebevoll nennen die Oberderdinger den 82-jährigen Wagner Carl Renz „den letzten seines Standes“. Wie zuletzt beim Oberderdinger Jubiläumsumzug bringt er seine herausragenden Berufskenntnisse immer wieder für die Allgemeinheit ein. Seit seiner Stellmacher-Lehrzeit geht Carl Renz wegen der verschiedenen Holzarten mit besonders offenen Augen durch die Feld- und Waldflur. Bei einem seiner Spaziergänge mit seiner Frau Elisabeth entdeckte er an einem wild verwucherten Feldrain auf Oberderdinger Gemarkung die von ihm seit Jahrzehnten vermisste Zwetschgensorte „Bockschelle“.
Bei der Verkostung einiger Zwetschgen erinnerte sich Carl Renz wehmütig an seine Kinder- und Jugendzeit, als seine Mutter Sofie köstliche Zwetschgenkuchen der Sorte „Bockschelle“ gebacken hat. Manchmal entnahm er sogar den frischen Kuchen direkt aus dem Ofen, was öfters auch mit etwas Bauchweh verbunden war. Natürlich wusste Carl Renz, dass es sich bei dem Namen „Bockschelle“ um eine lokale Namensgebung der Sorte für Oberderdingen und Umgebung handeln musste, und bat deshalb kürzlich den Pomologen-Verein um weitere Auskünfte. Die Lösung brachten die Biologin und Pomologin Dr. Annette Braun-Lüllemann sowie der Biologe und Steinobstforscher Dr. Walter Hartmann. Nach Begutachtung der Zwetschgenfrüchte und –steine wurde die Lokalsorte „Bockschelle“ als Rote Dattelzwetschge identifiziert.
Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte der Würzburger Hofgärtner Johann Prokop Meyer in seinem dreibändigen Standardwerk „Pomona Franconica“ die alte Sorte beschrieben. Leider kommt die festfleischige Sorte mit ihrer eigenartigen Form nur noch selten in Baden-Württemberg vor.
Carl Renz erinnert sich, dass vor Jahrzehnten noch mehrere „Bockschellen“-Bäume auf Oberderdinger Gemarkung standen und sich durch die wurzelechten Bäume durch Bodenausläufer ganze Zwetschgen-Heckenraine gebildet hatten. Die Anfang bis Mitte August reifenden Früchte mit ihrem goldgelben Fruchtfleisch sind saftig und süß und haben einen aromatischen Geschmack. Die purpurrote Frucht ist leicht bläulich bereift und bei guter Reife löst sich der Stein problemlos vom Fruchtfleisch. Nachdem seine Ehefrau Elisabeth einen delikaten „Bockschellen“-Zwetschgenkuchen wie zu Mutters Zeiten gebacken hatte, entstand bei Carl Renz wieder das tiefe Gefühl von Heimat. Umso mehr als Klaus Rupp vom OGV Rohrbach a.G. durch ungeschlechtliche Vermehrung mittels ruhender Knospen den Bestand der „Oberderdinger“ Sorte sicherte.
Klaus Rupp
Apfelsaft aus rotfleischigen Äpfeln in Kraichtal-Unteröwisheim präsentiert
Ende August 2015 besichtigten 30 Teilnehmer um die stellvertretende Landessprecherin des Pomologen-Vereins, Zori Dierolf (Löchgau) und dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Rietenau, Alfred Binder, die im vollen Behang stehende Blutapfelanlage in Kraichtal-Unteröwisheim. Nun stand in Unteröwisheim am 18.09.2015 im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Besenwirtschaft „Kannenbesen“ die Präsentation des frisch abgefüllten und ungefilterten roten Apfelsaftes an. Hierzu waren der Kraichtaler Bürgermeister Ulrich Hintermayer, Karlheinz Glaser (1. Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins) und Klaus Rupp vom OGV Rohrbach a.G. in die Besenwirtschaft der Brüder Kurt und Klaus Gärtner gekommen. Nachdem die Familien Gärtner seit ein paar Jahren Most aus den rotfleischigen Äpfeln sowie das Fruchtspeiseeis „Melarossa“ anbieten, gehört nun erstmals roter Apfelsaft zur Angebotspalette. Alle überzeugten sich von der guten Qualität des erfrischenden Saftes aus den rotfleischigen Äpfeln.
Klaus Rupp vom Obst- und Gartenbauverein Rohrbach am Gießhübel, aktives Mitglied der Landesgruppe Baden-Württemberg des Pomologen-Vereins, berichtete über die Entstehungsgeschichte der rotfleischigen Apfelsorte „Roter Mond“. Dem berühmten russischen Botaniker und Obstbaupionier Iwan W. Mitschurin (1855-1935) gelang es, über 300 neue frostresistente Obstsorten für das kontinentale Klima Russlands zu züchten. Sein größter Erfolg war 1915 die Apfelsorte „Roter Mond“. Neben der Schale, dem Fruchtfleisch und den Kernen sind auch das Holz, die Blüten und Blätter von intensivem Rot durchzogen. Der in Rohrbach a.G. gebürtige Direktor der Badischen Lebensmittel-Untersuchungsanstalt und Hochschullehrer in Karlsruhe, Professor Gustav Rupp (1853-1944) stand bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts im Forscherkontakt mit Mitschurin. Bedingt durch den 1. Weltkrieg kam es zu einem Stillstand der Beziehungen. Professor Rupp, der von 1900 bis 1927 auch dem Reichsgesundheitsrat in Berlin angehörte, knüpfte um 1920 wieder erste Kontakte zu Mitschurin. Gustav Rupp, Professor für Lebensmittelchemie, hatte bereits 1893 das Lehrbuch „Die Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel sowie der Gebrauchsgegenstände“ veröffentlicht. Das Werk gehörte in jener Zeit zu den ersten derartigen Abhandlungen und sollte Chemikern, Medizinalbeamten, Pharmazeuten, Verwaltungs- und Justizbehörden bei der Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen als Richtschnur dienen. Angesichts der steigenden Not der Bevölkerung nach dem 1. Weltkrieg schlug Professor Gustav Rupp den flächenmäßigen Anbau der rotfleischigen Apfelsorte zur Mostwein-Herstellung in Baden vor. Er war der Meinung, dass die Urkraft der roten Pflanzenfarbstoffe das Wohlbefinden und die Vitalität der badischen Bevölkerung verbessern könnte. Aber es war aus politischen Gründen nicht möglich, die Züchtung des glühenden Lenin- und Stalin-Verehrers Mitschurin in Baden durchzusetzen. Über die Berliner Baumschule Späth bezog Gustav Rupp Veredelungsreiser der Sorte „Roter Mond“. An einem Geheimstandort auf Gemarkung seiner Heimatgemeinde Rohrbach a.G. wurden die Edelreiser auf eine Bittenfelder-Sämlingsunterlage aufveredelt. Leider wurde der Baum im Rahmen der Flurbereinigung im Jahr 1967 gerodet. Aber durch die rechtzeitige Entnahme von Edelreisern durch Oskar und Klaus Rupp wurde die rotfleischige Apfelsorte erhalten. Längst hat die Wissenschaft das hohe Gesundheitspotential der rotfleischigen Äpfel festgestellt, was in den letzten Jahren zu Neuzüchtungen rotfleischiger Apfelsorten führte.
Klaus Rupp
Streuobstbau: Oeschberg-Palmerschnitt in Sennfeld
Zu einem speziellen Schnittkurs für großkronige Obstbäume hatte die Landesgruppe Baden-Württemberg des Pomologen-Vereins auf ein Feldgrundstück nahe des Aussichtspunkts „Lichte Eiche“ auf Gemarkung Sennfeld geladen. Unbeeindruckt von nasskalter Witterung und Dauernieselregen folgten die 20 zum Teil weit angereisten Teilnehmer um den Landessprecher Hermann Schreiweis aus Roigheim den Ausführungen des Kursleiters Helmut Ritter aus Strümpfelbach (Remstal).
Ritter, ehemaliger Schüler des Pomologen und „Remstalrebellen“ Helmut Palmer, führte zu Beginn sehr anschaulich in die theoretischen Grundlagen des Oeschberg-Palmerschnitts ein. Die Schnittmethode wurde ab 1920 von Dr. Hans Spreng in der Schweiz entwickelt und von dem Obstbauexperten Helmut Palmer nach dem Zweiten Weltkrieg in Württemberg weiterentwickelt.
Beim Oeschberg-Palmerschnitt gibt es keine über mehrere Etagen angeordneten Gerüstäste, die das Kroneninnere überbauen und die unteren Kronenbereiche beschatten. Denn durch den Lichtmangel verkahlen viele Äste und es entstehen Schattenfrüchte.
In einer über dreistündigen Schnittdemonstration stellte Ritter zwei etwa 20-jährige Apfelbäume nach der Oeschberg-Palmermethode um. Es wurden jeweils Baumkronen erzielt, die aus drei bis vier steilen Leitästen sowie einer spindelförmigen Stammverlängerung bestehen, an denen sich sogenannte selbsttragende begleitende Fruchtäste befinden. Diese Äste sind mit Fruchtholz garniert. Helmut Ritter meinte, das Hauptaugenmerk sei auf die Stabilisierung der neu geschaffenen Leitastfortsätze und die begleitenden Fruchtäste zu richten, was nur durch Rück- und Anschnitt der jeweiligen Spitzen erreicht werden kann. Er erläuterte, dass die künftige Fruchtlast der außen angehängten begleitenden Fruchtäste sowie der untergeordneten Fruchtäste die Leitäste automatisch etwas nach außen zieht. Auch hierdurch sei das Eindringen des Sonnenlichts bis in die untersten Baumbereiche gewährleistet. Er wies auch auf die geringere Unfallgefahr hin, denn da die Leit- und begleitenden Fruchtäste keine Seitenäste haben, können die Leitern seitlich an den Leitästen angelegt werden. Im Vereinsheim des Fußballvereins Sennfeld vertiefte Ritter nochmals die erworbenen Kenntnisse und zeigte an mitgebrachten jungen Hochstammbäumen den Pflanzschnitt.
Klaus Rupp
Blütenrundgang in Gärtners Blutapfel-Obstanlage

Mit dem legendären Verführungsmittel Apfel fing dereinst bekanntlich alles an. Aber nicht irgendeine Apfelsorte ist in einer der Familien Klaus und Kurt Gärtner in Unteröwisheim im Spätjahr zu erwarten, sondern Äpfel aus „Fleisch und Blut“ ...
Dazu sind folgende Zeitungsartikel erschienen:
Artikel lesen im Eppinger Stadtanzeiger ...
Artikel lesen im Mittteilungsblatt der Stadt Kraichtal ..

In St. Leon-Rot im Süden des Rhein-Neckar-Kreises hat sich der Golf Club schon vor einiger Zeit entschlossen, seine weitläufigen Flächen auch für eine nachhaltige Streuobstpflanzung zu nutzen. Erwin Holzer, Oberdieck-Preisträger 2002, hat dafür ein Konzept initiert, bei dem 31 Gemeinden und Städte der Region jeweils eine Obstsorte übernehmen, die in mehreren Exemplaren aufgepflanzt wird.
Eine derart vollständige Sammlung lokaler und regionaler Obstsorten ist selten in Deutschland. Etwa 2/3 der Bäume sitzen bereits an ihrem angedachten Platz und werden bewässert und gepflegt, im kommenden Jahr sollen alle Arbeiten inkl. Beschilderungen und eines Faltblatts abgeschlossen sein und mit einem großen Fest gefeiert werden.